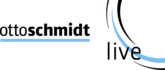Der US-Präsident legt sich mit Twitter und Co. an und will die Plattformen in die Haftung nehmen. Der Vorstoß befeuert auch in Europa die Diskussion um das Providerprivileg, wie Tobias Keber analysiert. Nun will auch die EU nachregulieren.
Die Reaktion aus dem Weißen Haus ließ nicht lange auf sich warten. Der US-Präsident Donald Trump hatte sich auf seinem Lieblingskurznachrichtendienst Twitter zur Briefwahl geäußert, und diese kritisiert. Daraufhin hatte Twitter sein Posting einem Faktencheck unterzogen, und Quellen zusammengestellt, die die Einschätzung Trumps widerlegen. Trump reagierte empört und warf Twitter Zensur und Meinungsmanipulation vor.
In der Nacht zum Freitag, den 29. Mai 2020 veröffentlichten die Mitarbeiter Trumps dann eine Exekutivanordnung des Präsidenten. Dort werden Maßnahmen zu Section 230 des "Communications Decency Act" angekündigt. In dem Rechtsakt ist seit Ende der 1990er Jahre das Providerprivileg geregelt, wie man es grundsätzlich auch in Europa in unterschiedlicher Ausgestaltung für Access- und Host-Provider zu Gunsten von Plattformen wie Twitter, Facebook und YouTube kennt.
Tod dem Providerprivileg!
In der Executive Order Trumps wird nun ein Konzept in Aussicht gestellt, wonach Twitter in dem Moment das Haftungsprivileg verlieren würde, wo der Dienst aufgrund seines Hausrechts (Terms of Service) interveniert und auf den Inhalt eines Tweets einwirkt, indem beispielsweise an einem Posting ein Hinweis zu einem Fact-Check angebracht wird.
Ebenfalls noch am 29. Mai 2020 legte Twitter nach. Ein Tweet des US-Präsidenten wurde ausgeblendet und mit dem Hinweis versehen: "Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter Regeln zur Gewaltverherrlichung. Twitter hatte jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Tweet zugänglich zu lassen." Sodann wird der Originalinhalt des Postings wiedergegeben, der sich mit den Protesten nach dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz beschäftigt und den Protestlern mit drastischen Mitteln droht, sinngemäß schrieb er: "Wenn das Plündern beginnt, dann wird geschossen".
Die Geschehnisse in den USA haben eine Debatte ausgelöst, die auch hierzulande enorm polarisiert. Während einige mit dem mutmaßlichen Ende zentraler Aspekte des Providerprivilegs die Grundfesten des Internets erschüttert sehen, erwägen andere notwendige Anpassungen, bzw. eine Feinsteuerung des Providerprivilegs für das Internet des 21. Jahrhunderts. Zugespitzt wird bisweilen sogar gefragt, ob der US-Präsident mit seinem Vorstoß nicht (ausnahmsweise) sogar richtig liegt, richtet er sich jedenfalls dem Grunde nach auch gegen das Diktat willkürlich durch die Plattformen festgelegter Nutzungsbedingungen.
Das Providerprivileg ist tot
Würde sich (was nach US-amerikanischem Recht formell und materiell fraglich ist) das Konzept Trump durchsetzen, lägen die Folgen hierzulande für Faktenchecker-Initiativen der Social Media Plattformen auf der Hand: Facebook, Twitter und Co. müssten fürchten, für einen fehlerhaften Faktencheck haftungsrechtlich in Anspruch genommen zu werden. Aus ökonomischen Gründen liegt für die Plattformen dann nahe, auf dieses Feature gänzlich zu verzichten.
Ein rechtsvergleichender Blick zur Situation diesseits und jenseits des Atlantiks zeichnet das folgende Bild. Bemerkenswert ist schon die dem Vorschlag offenbar zu Grunde liegende Haltung des US-Präsidenten, wonach er sich auf die Meinungsfreiheit beruft und sich als Opfer einer Zensur durch Twitter inszeniert. Innerhalb unseres Mediensystems müsste man die Frage stellen, ob sich ein Staatsoberhaupt in Ansehung seiner offiziellen Kommunikation überhaupt auf Grundrechte berufen kann. Fraglich ist auch, ob ein privates Unternehmen im Rechtssinne zensieren kann, da Zensur vom Staat ausgehen muss.
Auch in welchem Maße die Meinungs-, bzw. Informationsfreiheit zu Gunsten eines Plattformanbieters wie Twitter ins Feld geführt werden kann, bedarf eingehender Reflexion. Damit untrennbar verwoben ist das Problem der fehlenden unmittelbaren Grundrechtsbindung von Privaten, das die Rechtsprechung auch hierzulande nach wie vor intensiv beschäftigt.
Twitter und Co. machen sich Inhalte durch Faktencheck nicht zu eigen
Grundsatzfragen der Verantwortlichkeit und ihrer Verteilung zwischen unterschiedlichen Akteuren im Internet sind hierzulande in §§ 7 ff. Telemediengesetz (TMG) geregelt, die ihrerseits unionsrechtliche Wertungen reflektieren (abgebildet werden Artikel 12 ff. der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, 2000/31 vom 8. Juni 2000). Im Grundsatz unterscheidet man demnach Anbieter eigener Inhalte (Content-Provider) einerseits und Anbieter, die Inhalte Dritter vermitteln, wobei jene als reine Zugangsvermittler (Access-Provider) oder solche erscheinen, die zumindest faktisch auch Zugriffsmöglichkeiten auf die Inhalte haben (Host-Provider). Anbieter eigener Inhalte (Content-Provider) dagegen sind für von ihnen veröffentlichte Informationen voll verantwortlich, für sie gilt keine Privilegierung. Gleiches gilt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch für die Verbreitung fremder Informationen, die sich ein Anbieter aktiv zu eigen gemacht hat
Was die Verantwortlichkeit der Host-Provider angeht, galt sodann als Grundregel, dass diese für rechtswidrige Inhalte Dritter erst ab Kenntnis der Rechtswidrigkeit haften und Inhalte gegebenenfalls von der Plattform nehmen müssen (notice and take down). Im hergebrachten System würde man also Twitter als Host-Provider für die Inhalte Dritter qualifizieren und dem Dienst das Haftungsprivileg zusprechen.
Wenn ein Dienst wie Twitter einem Posting einen Hinweis zum Faktencheck hinzufügt, könnte man nun fragen, ob hierdurch ein zu eigen machen vorliegt – was man nach den gängigen Kriterien der höchstrichterlichen Rechtsprechung aber verneinen müsste. Der Hinweis hat ja gerade ein vom Inhalt distanzierendes Moment. An diesem Ergebnis dürfte auch das neuerliche Urteil des OLG Karlsruhe in Sachen Tichys Einblick vs Correctiv nichts ändern, da es vor wettbewerbsrechtlichem Hintergrund und nur für das Verhältnis Faktenchecker (Correctiv) vs. untersuchter Inhalt (redaktioneller Inhalt Tichys Einblick) aussagekräftig ist.
Keine stringente Providerregulierung im deutschen Recht
Von der oben dargestellten "reinen Lehre" der im TMG normierten Providerprivilegien ist in Europa aber schon lange keine Rede mehr. Zahlreiche Ausnahmen wurden zum Teil im Wege richterlicher Rechtsfortbildung etabliert, bereichsspezifisch gab es auch von Seiten des Gesetzgebers feinsteuernde Interventionen. Mit der Rechtsprechung zur Störerhaftung (als Ausnahmekonzept für nicht dem Providerprivileg unterfallende Unterlassungsansprüche) für Rechtsverletzungen des Urheberrechts kann man ganze Bibliotheken füllen, die Abschaffung der W-LAN Störerhaftung brauchte mehrere gesetzgeberische Anläufe. Einen wirksamen Hebel gegen Hate Speech im Netz sollte das NetzDG liefern, auch hier ist nach Auffassung des Bundesjustizministeriums aber ein weiteres Update erforderlich, in dem die Infrastrukturbetreiber noch weiter in die Pflicht genommen werden.
Pathologisch für das Providerprivileg in seiner ursprünglichen Form sind auch neuerliche Auffächerungen unter den "Dienstetypen" auf unionsrechtlicher Ebene. "Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten", nach traditioneller Lesart ebenfalls Host-Provider, sollen nach dem jüngsten Update der Urheberrechtsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/790 vom 17. April 2019, sog. DSM-RL) für eine durchgängige Lizensierung der verbreiteten Inhalte sorgen oder mit technischen Maßnahmen gegen rechtswidrige Uploads vorgehen (Art. 17, sog. Uploadfilter). Die Umsetzung dieser Vorgaben durch den nationalen Gesetzgeber steht noch aus. Daneben haben nach der jüngsten Änderung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (Richtlinie 2018/1808 v. 14. November 2018 zur Änderung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) die Mitgliedstaaten angemessene Maßnahmen dahingehend zu treffen, damit "Video-Sharing Provider" die Allgemeinheit vor nutzergenerierten Videos zu schützen, in denen zu Gewalt oder Hass gegen eine Gruppe von Personen aufgestachelt wird (Art. 28b der geänderten AVMD-Richtlinie). Damit korrespondieren Änderungen im künftigen Medienstaatsvertrag, die Dienstanbieter ebenfalls weiter ausdifferenzieren (u.a. "Medienplattform", "Medienintermediär", "Video-Sharing-Dienste") und diese Anbieter jedenfalls zu mehr Transparenz und auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung verpflichten.
Die nachgezeichnete Genese eines "modernen" Providerprivilegs erscheint aber insgesamt als kasuistischer und heterogener Flickenteppich, der von einem dogmatisch stringenten Gesamtkonzept für einen rechtsgebietsübergreifenden Ansatz ebenso weit entfernt ist wie die Twitter Kommunikation des US-Präsidenten von staatsmännisch besonnener Zurückhaltung geprägt ist.
Lang lebe das Providerprivileg!
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte schon vergangenes Jahr einen Entwurf für einen Digital Services Act angekündigt, der auch die Haftung von Informationsvermittlern, (Intermediären) betreffen und damit die Haftungsregeln der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr aus dem Jahr 2000 reformieren könnte.
Für eine Anpassung der Regelungen spricht, dass die originär sehr weitreichende Privilegierung der Host-Provider in einzelnen Bereichen angesichts der technischen Fortentwicklung, etwa durch den Einsatz von Algorithmen bei der Priorisierung angezeigter Inhalte, nicht mehr sachgerecht erscheint. Andererseits muss man aber sehen, dass es sich bei dem Providerprivileg nach wie vor um ein wichtiges Institut handelt, das für die Entwicklung des Internets als freiem Kommunikationsraum von zentraler Bedeutung ist. Anpassungen des Gesetzgebers müssen daher mit hinreichender Sensibilität für das die Problematik umspannende komplexe Grundrechtegeflecht erfolgen. In fairen Ausgleich zu bringen sind die Interessen der Inhalte einstellenden User ebenso wie die von diesen Informationen gegebenenfalls betroffene Dritte, die nicht nur, aber vor allem wirtschaftlichen Interessen der vermittelnden Plattform und solche der die Inhalte nur passiv nachfragenden User.
Vom Dogma, dass soziale Netzwerke als bloße Infrastruktur ohne Bezug zu den Inhalten erscheinen, muss man sich ebenso lösen wie von der Annahme, dass die Vorgaben der Medienregulierung grosso modo auf den Bereich der sozialen Netzwerke übertragen werden können.
Jetzt ist die Zeit
Zentraler Punkt für die Ausgestaltung eines zeitgemäßen Providerprivilegs dürfte also die Absage an das Prinzip "one size fits all" zu Gunsten eines gestuften Konzepts sein, das eine weitergehende Verantwortlichkeit mit zum Teil auch proaktiveren Pflichten für den Fall statuiert, dass eine systemisch besonders relevante Plattform agiert. Dies könnte man in teilweiser Anlehnung an das Rundfunkrecht an das Kriterium der Meinungsbildungsrelevanz knüpfen, das gesetzgeberisch näher ausgestaltet werden müsste. Damit ließen sich auch Vorgaben verbinden, die auf eine Demokratisierung (Beteiligung von Usern oder externen Sachverständigen mit Entscheidungskompetenz) bestimmter Plattformen, bzw. ihres Hausrechts (Terms of Service) hinwirken.
Schritte in die richtige Richtung gibt es bereits, wie das jüngst personell weiter besetzte Facebook Oversight Board zeigt.
Am 2. Juni 2020 hat die Europäische Kommission nun den öffentlichen Konsultationsprozess eingeleitet. Meinungen zum Legislativpaket über digitale Dienste (Digital Services Act) können noch bis zum 8. September abgegeben werden.
Unabhängig davon, ob Trumps Vorstoß in den USA Erfolg haben wird oder eher nicht, er hat die Diskussion in Europa zusätzlich befeuert. Für die Diskussion in Europa wünscht man sich indes konstruktive Vorschläge, gerne differenziert und weniger impulsiv, als dies bei der Social-Media-affinen Öffentlichkeitsarbeit des US-Präsidenten der Fall ist.
Prof. Dr. Tobias Keber ist Professor für Medienrecht und -politik an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Auf Twitter ist er unter @datenreiserecht zu finden.
Providerprivileg in USA und Deutschland: . In: Legal Tribune Online, 05.06.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/41815 (abgerufen am: 01.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag