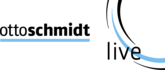Seite 2/2: Ob Geld zum Mitgefühl angetrieben hat?
Die faire "Bordellzinsen-Entscheidung", die festhielt, dass der Staat keine Einkünfte besteuert, für deren Zustandekommen er keinen Rechtsschutz leistet, enthielt eine weitere interessante Feststellung: Der Nutznießer aus dem Bordellgeschäft hatte in seinen Steuererklärungen Fehler gemacht, die überhaupt zum Strafprozess führten. Einerseits "vergaß" er gewisse Einkünfte, für die Steuerpflicht bestand. Andererseits hatte er im Ergebnis – weil er die "Bordellzinsen" irrtümlich für abgabepflichtig hielt – zu viel Steuern gezahlt.
Heute wäre das ein Fall für das Kompensationsverbot: "Nicht nur dem juristischen Laien, sondern auch manchem Juristen ist es unverständlich, dass ein Täter wegen vollendeter Steuerhinterziehung gemäß § 370 [Abgabenordnung] verurteilt werden kann, obwohl gleichzeitig ein negativer Saldo besteht, d.h. ihm ein Rückerstattungsanspruch zusteht", schreibt Eva Fischbach in ihrem historischen Aufriss zum Kompensationsverbot (Bucerius Law Journal 2010, S. 3-8).
Der Begünstigte aus den "Bordellzinsen" hatte nach dem Urteil des Reichsgerichts "nicht nur den seiner Anmeldung entsprechenden Steuersatz von 212 Mark, sondern einen noch weit höheren entrichtet nämlich von … 390 Mark". Eva Fischbach dokumentiert, dass es 1919 bei der Einführung des Kompensationsverbots auch darum gegangen sei, den Strafrichtern komplexes Nachrechnen zu ersparen – was allerdings paradox ist, weil sie es bei der Strafzumessung doch tun müssten.
Juristenschwemmebremse als Grund für Bordellrentnerempathie?
Es ist vielleicht nicht unangemessen zu behaupten, dass die Reichsgerichtsräte 1912 ganz gerne ihre umfangreichen und im Urteil dokumentierten Kompensationsrechnungen aufmachten. Was heute – mit 3 Prozent und 212 beziehungsweise 390 Mark – als erfreulich geringe Einkommensteuer gilt, könnte den Juristen seinerzeit Mitgefühl zum eher anrüchigen Kieler Rotlichtunternehmer vermittelt haben: Gegen "Juristenschwemme" beugte man zu Kaisers Zeiten vor, indem "der Referendar dem preußischen Staat einen 'standesgemäßen Unterhalt' von mindestens 1.500 Mark jährlich nachweisen und einen Betrag von 7.500 Mark in bar hinterlegen" musste (Zahlen bei Dieter Kolbe: "Reichsgerichtspräsident Dr. Erwin Bumke").
Vermutlich haben Juristen zum Steuerhunger ihres Staates ein anderes Verhältnis, wenn sie schon während ihres Referendariats vom Fiskus alimentiert werden – statt selbst für einen "standesgemäßen" Lebenswandel eigenes Geld nachweisen zu müssen. Oder ist es arg beleidigend zu unterstellen, dass solche Rahmenbedingungen auf die Würdigung zum Beispiel des Kompensationsproblems durchfärben können?
Wie sich Juristen ungestraft beleidigen
Zum Schluss also lieber eine ungefährliche Beleidigung: Höchstrichter beschimpfen "Vorderrichter", das Reichsgericht zeigt, dass es im Landgericht Berlin Narren vermutet. Im Urteil vom 22. November 1912 (RGSt 46, 326, Az. II 820/12) monieren die Reichsgerichtsräte einen Widerspruch bei den Berlinern: Das Landgericht hatte in den Urteilsgründen für zwei Fälle "des vollendeten Betrugs je 9 Monate und den versuchten Betrug 6 Monate Gefängnis" zu einer "Gesamtstrafe von 1 Jahr 6 Monaten zusammengezogen, worauf 6 Monate der Untersuchungshaft angerechnet wurden". In der verkündeten Urteilsformel hieß es jedoch, dass die Angeklagte "zu einem Jahre Gefängnis, worauf sechs Monate Untersuchungshaft angerechnet werden" verurteilt sei.
Ein Widerspruch von sechs Monaten Freiheit oder Elend. Die Leipziger Richter hielten die Berliner Kollegen offenbar für recht aufklärungsbedürftig, weil sie das widersprüchliche Urteil nicht nur aufhoben, sondern erklärten: "Daß in dem neuen Urteil eine härtere Strafe als 1 Jahr 6 Monate Gefängnis nicht erkannt werden darf, ergibt sich aus § 398 Abs. 2 StPO."
In einem unterscheiden sich die Juristen von 1912 von ihren bloggenden Kollegen des Jahres 2012 jedenfalls nicht: Wollen sie sich untereinander beleidigen, klären sie sich über eine ganz offensichtliche Rechtslage auf.
(Bevor Sie jemanden beleidigen: Die heutige "Hausnummer" lautet „358 II“.)
Martin Rath, Rechtsgeschichten 1912: . In: Legal Tribune Online, 04.11.2012 , https://www.lto.de/persistent/a_id/7449 (abgerufen am: 05.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag