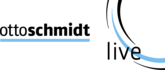Am Reichsgericht zu Kaiser Wilhelms Zeiten kann man schon einen Narren fressen. In einigen jetzt 100 Jahre alten Entscheidungen finden sich z.B. gleich zwei interessante Gedanken auf nur 31 Druckseiten – man vergleiche das mal mit dem Bundesverfassungsgericht. Auch ein Meilenstein christdemokratischen Sozialrechts wurde 100 Jahre, ohne dass jemand feierte. Ein Narrenfutter von Martin Rath.
Wenn die Untertanin keine Gegenleistung für ihr Steuergeld bekommt, muss sie auch nicht zahlen – gerade weil sie der "gewerbsmäßigen Unzucht" nachging. Die in der Entscheidungssammlung (RGSt 46, 237-268) hübsch didaktisch formulierte Frage: "Unterliegen in Preußen Einkünfte aus Kapitalforderungen, die nach §§ 138. 139 BGB. nichtig sind, insbesondere sog. Bordellzinsen, der Einkommensteuer?", verneinte das Reichsgericht in einem Urteil vom 14. Oktober 1912 (Az. III 320/12).
Dass der Untertan dem Staat nicht aus nahezu jedem Einkommen Steuern zahlen muss, ist der erste überraschende Gedanke in dieser sogenannten "Bordellzinsen-Entscheidung" des Reichsgerichts, an die sich heutzutage Steuerjuristen gerne erinnern, weil der Bundesfinanzhof 50 Jahre später zu einem anderen Ergebnis kommen sollte.
Rechtsstaat widerspricht sich nicht – auch nicht beim Geld
In der preußischen Provinz, dem "Reichskriegshafen" Kiel, hatte der Angeklagte zwei Grundstücke zum außergewöhnlich hohen Preis von 105.000 Mark verkauft – gegen Stellung einer Hypothek, aus der ihm im Steuerjahr 1903 3.380 Mark zuflossen. Zum Vergleich: um 1900 verdiente ein Arbeiter durchschnittlich rund 800 Mark jährlich. Für seine Gesamteinkünfte in Höhe von 13.281 Mark entrichtete der Mann 390 Mark Einkommensteuer an den preußischen Staat, was einem Satz von knapp 3 Prozent entspricht.
Das war in der Berechnungsgrundlage zu viel des Guten. Denn auf den beiden Grundstücken wurden von der Erwerberin Bordelle weiterbetrieben, der hohe Verkaufspreis war mit Blick auf diese Einkommensquelle zustande gekommen. "Gewerbsmäßige Unzucht" finanzierte die Hypothekenzinsen, was den Richtern missfiel.
Das preußische Einkommensteuergesetz erfasste zwar "Kapitalforderungen jeder Art", jedoch stellten die Kieler Strafkammer und das Leipziger Reichsgericht fest, dass die Kapitalforderungen nur insoweit erfasst werden dürften "als dem Steuerpflichtigen auf ihre Ausnutzung ein Rechtsanspruch zusteht". Obwohl über die Hypothekeneintragung gleichsam "gewaschen", wollte der Staat des Jahres 1912 Einkünfte aus "Bordellzinsen" nicht besteuern, weil er zur Durchsetzung der sittenwidrigen Forderungen aus Prostitution keinen Rechtschutz gewährte. Das Reichsgericht wörtlich: "Der Rechtsstaat würde mit sich selbst in Widerspruch geraten, wollte er einerseits den Steuerpflichtigen nötigen, derartige Einnahmen zu versteuern, andererseits ihm seine Hilfe versagen, wenn er sie im Rechtsweg klagend oder einredeweise geltend machen will."
Warum am Reichsgericht Narren fressen?
"Pecunia non olet, Geld stinkt nicht", ist bekanntlich ein ungeschriebenes Prinzip des Steuerrechts, der Bundesfinanzhof entschied am 23.6.1964 dem entsprechend – pikanterweise im Fall einer 1957 verstorbenen Prostituierten, deren Tochter und Erbin neben der Einkommensteuer auch für das "Notopfer Berlin" sowie die Kirchensteuer nachveranlagt wurde (Az. Gr. S. 1/64 S). Dass der Staat nicht besteuern soll, wofür er keinen Rechtsschutz leistet, könnte man daher als nette liberale Idee aus einer verstaubten juristischen Ära abtun. Warum also am Reichsgericht Narren fressen?
Vielleicht, weil sich – neben prinzipienfesten Urteilen – auch bemerkenswerte Juristen in den Leipziger Sälen fanden. Über lebende und frisch verstorbene Angehörige der Juristenzunft wird ja fast nur überfreundlich berichtet, erst unter den älteren Semestern gibt es das komplette Doppelgesicht.
Im Jahr 1912, als deutsche Professoren über ihre Spitzbärte stolperten und preußische Frauen vom juristischen Staatsdienst nur Mädchenträume hatten (zugelassen wurden sie erst 1922), finden wir beispielsweise den noch jungen Erwin Bumke (1874-1945) als "Kommissar" des Reichsjustizamtes beim Reichstag, involviert in Reformbemühungen zur Schaffung eines modernen Jugendstrafrechts. Der spätere Reichsgerichtspräsident, der im "Dritten Reich" zum Lord Voldemort der deutschen Justiz werden sollte, zeigte sich auch sonst als erfrischend moderner Konservativer – ein Jurist, nach dem sich heute Recruiter die Finger lecken: "Gut" im großen Staatsexamen, hochbegabt in Fremdsprachen, Geigenspieler – zwischen Militärdienst und Referendariat ein Jahr Auslandsaufenthalt in der Schweiz, Frankreich, England, mit produktiven Forschungskontakten zur britischen und französischen Justiz.
Wenn ein – unter gegebenen Bedingungen – so moderner Jurist es später "mitmacht", dass aus dem Analogieverbot im Strafrecht eine Analogiepflicht nach "gesundem Volksempfinden" wird und Strafnormen rückwirkend anwendet – sollte man sich dann nicht der mitunter erstaunlich liberalen und prinzipienfesten Rechtskultur widmen, in der solche Köpfe groß wurden?
§ 248a StGB – 100 Jahre christdemokratischer Rechtskultur
Man nehme: eine wertorientierte Gesetzgebung. Am 5. Juli 1912 trat § 248a StGB in Kraft, im ursprünglichen Wortlaut: "(1) Wer aus Not geringwertige Gegenstände entwendet oder unterschlägt, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. (2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig. […]"
Wesentlichen Anteil am Zustandekommen dieser Norm hatte der Reichstagsabgeordnete Georg Wellstein (1849-1917) von der katholischen Zentrumspartei – nur eine Generation älter als der erste Kanzler der Bundesrepublik, der CDU-Mann Konrad Adenauer. Die neue Norm sollte verhindern, dass Kleindiebstähle mit "Gefängniß", also Haft von einem Tag bis zu fünf Jahren, sanktioniert werden. Privilegiert war bis dahin nur der sogenannte "Mundraub" an Nahrungsmitteln nach § 370 I Nr. 5 StGB.
Wie weit der soziale Gedanke im Strafrecht gehen sollte, beschäftigte sogleich die Berliner Staatsanwaltschaft und schon im Herbst 1912 auch das Reichsgericht. Das Urteil vom 12. November 1912 beginnt mit einer Beschreibung des Angeklagten, die noch heute viele Nicht-Berliner an die alte und neue Hauptstadt erinnert (Az. II 880/12, RGSt 46, 265-268): "Der Angeklagte, seit 13. März 1912 ohne ertragbringende Arbeit, faßte am 1. April 1912 den Entschluß, durch Diebstahl in den Besitz von Geld zu gelangen."
Dazu griff er im Gedränge am Ausgang eines Kaufhauses – einer neumodischen Einrichtung – mit der linken Hand nach der Handtasche einer Frau, die das gute Stück aber nicht aus den Händen ließ. Die Berliner Staatsanwaltschaft vertrat die Auffassung, dass sich als geringwertige Gegenstände nur "solche Sachen ansehen [lassen], die geeignet und bestimmt seien, einer augenblicklichen Notlage des Täters … unmittelbar abzuhelfen – durch alsbaldigen einmaligen oder dauernden oder alsbaldigen Verbrauch (z.B. Geld) –, nicht dagegen Luxussachen (z.B. Bilder, Damenhutfedern)", die erst verkauft werden müssten, um Mittel zur Linderung der Not zu erzielen.
Dass Reichsgericht widersprach dieser Rechtsauffassung, wonach die gestohlene Sache unmittelbar zur Linderung der Not beitragen müsse – es genüge nach dem Wortlaut und der Diskussion im Reichstag, dass sich der stehlende Mensch als solcher in Not befinde.
Vergifteter Tropfen sozialen Öls
Allerdings war der "Tropfen sozialen Öls", mit dem 1912 das StGB nachträglich "gesalbt" wurde, leicht giftig, denn die Begründung lebt vom Gedanken feststehender sozialer Menschentypen: "Der Arme, der in seiner Bedürftigkeit ein geringwertiges Kleidungsstück entwendet, die Mutter, die das gleiche tut, um ihr Kind vor Kälte zu schützen, dürfen nicht mit gemeinen Dieben auf eine Stufe gestellt werden. Der stärkste Antrieb, der einen sonst rechtschaffenden Menschen aus den gesetzlichen Bahnen reißen kann, ist die Not und sie bedarf weitgehender Berücksichtigung."
Ein liberaler, "formalistischer" Rechtsgedanke lautet wohl: Ob Diebe arm oder reich sind, ist gleichgültig; indem man sie gleicher Strafandrohung unterwirft, erkennt sie das Recht als Gleiche an. Besonders milde war der Strafrahmen vom drei Monaten oder 300 Mark gar nicht einmal – in einer Gesellschaft, in der ein Arbeiter jährlich 800 Mark verdiente. Zudem legte der erforderliche Strafantrag samt Möglichkeit der Rücknahme die Staatsgewalt in die Hände der noch so geringfügig Bestohlenen.
Martin Rath, Rechtsgeschichten 1912: . In: Legal Tribune Online, 04.11.2012 , https://www.lto.de/persistent/a_id/7449 (abgerufen am: 05.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag