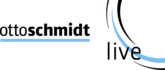Schluss mit Freizügigkeit: In der Schweiz soll es in Zukunft wieder feste Kontingente für den Zuzug von Ausländern geben. Wenn das Vorhaben wie geplant umgesetzt wird, ist ein Bruch der Abkommen mit der EU unausweichlich – und der wird Konsequenzen haben, vor allem für die Schweiz. Astrid Epiney skizziert die Rechtslage und zeigt einen möglichen Ausweg auf.
Um zu verstehen, was die am 9. Februar 2014 mit einer Mehrheit von 50,3 Prozent angenommene Initiative gegen Masseneinwanderung für das Verhältnis der Schweiz zur EU bedeutet, muss man zunächst die Geschichte und das derzeitige Vertragsgeflecht der Parteien kennen.
Der Beitritt der Schweiz zum europäischen Wirtschaftsraum (EWR) scheiterte 1992 an einem negativen Referendum. Daraufhin gestalteten die Schweiz und die EU ihre Beziehungen auf der Grundlage eines Netzes von inzwischen über 100 Abkommen in verschiedenen Bereichen, dies auch aufbauend auf einem Freihandelsabkommen aus dem Jahr 1972. Besonders prägend für das Verhältnis zwischen Schweiz und EU sind die sogenannten Bilateralen Abkommen I (1999) und II (2004). Erstere enthalten neben sechs weiteren Punkten (technische Handelshemmnisse, verarbeitete Landwirtschaftsprodukte, öffentliche Aufträge, Forschung, Land- und Luftverkehr) auch das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Schweiz. Diese insgesamt sieben Abkommen sind untereinander durch die sogenannte Guillotine-Klausel verbunden, so dass sie nur zusammen in Kraft treten konnten und die Kündigung eines der Abkommen automatisch auch die Übrigen zu Fall bringt.
Das Abkommen zur Personenfreizügigkeit sieht weitgehende Freizügigkeitsrechte vor, die im Wesentlichen dem Stand des EU-Rechts im Jahr 1999 entsprechen. Rechtstechnisch gesehen handelt es sich dabei, wie auch bei allen übrigen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, um ein völkerrechtliches Abkommen. Sein Inhalt lehnt sich jedoch in weiten Teilen an das EU-Recht an, was teils durch identische Formulierungen, teils durch direkte Verweise auf Sekundärrecht erfolgt.
Schweizer Initiative stellt Abkommen mit der EU in Frage
Die Schweizer Initiative, deren Ergebnis sich nun im Art. 121a der Bundesverfassung (BV) spiegelt, stellt dieses Abkommen nun in Frage. Sie verlangt zunächst allgemein eine autonome "Steuerung" der Einwanderung durch die Schweiz. Dies soll durch die Festlegung von jährlichen "Höchstzahlen“ und "Kontingenten" für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen für Ausländerinnen und Ausländer geschehen, wobei alle "Kategorien" einbezogen sind (also unter anderem auch Asylbewerber, Personen, die im Familiennachzug kommen, Grenzgänger, etc). Diese Kontingente sind so festzulegen, dass dem "gesamtwirtschaftlichen Interesse" der Schweiz Rechnung getragen wird. Die Einzelheiten sind auf dem Gesetzeswege festzulegen. Außerdem wird die Regierung verpflichtet, innerhalb von drei Jahren Abkommen, die mit dieser Bestimmung in Konflikt stehen, neu zu verhandeln und anzupassen; neue Abkommen, die nicht mit Art. 121a BV vereinbar sind, dürfen nicht abgeschlossen werden.
Diese Skizzierung der Initiative lässt das Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Personenfreizügigkeit erkennen: Sowohl das EU-Recht als auch das diesem insoweit nachgebildete Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz – EU gehen davon aus, dass im Falle der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen (zum Beispiel Arbeitnehmereigenschaft, Familienzugehörigkeit oder genügende Ressourcen) ein individuelles Recht besteht, sich in dem jeweils anderen Staat niederzulassen. Dieses Recht darf nicht eingeschränkt werden, so dass die Festlegung einer Höchstzahl von Aufenthaltsbewilligungen unzulässig ist.
Ein Einlenken der EU ist nicht zu erwarten
Auf den ersten Blick erscheint es somit unmöglich, die Initiative und das Freizügigkeitsabkommen miteinander zu vereinbaren. Auch eine Anpassung des Abkommens erscheint wenig realistisch, denn die Union und viele ihrer Mitgliedstaaten betonen vehement, dass man den Grundsatz der Personenfreizügigkeit nicht aushöhlen werde.
Im Gegenteil ist die EU in letzter Zeit bei Marktzugangsabkommen wie dem hier in Frage stehenden eher ambitionierter als nachlässiger geworden. Daher scheint es gut möglich, dass sie Neuverhandlungen nur auf der Grundlage der Unionsbürgerrichtlinie (die noch um einiges weiter geht als das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Schweiz) in Angriff nehmen würde. Zudem erscheint es auch praktisch kaum vorstellbar, dass sämtliche Mitgliedstaaten eine etwaige Modifikation des Freizügigkeitsabkommens ratifizieren würden, was angesichts des Charakters als gemischtes Abkommen aber notwendig wäre.
Entscheidet sich die Schweiz gleichwohl für eine Umsetzung der Initiative mittels fixer Kontingente, wäre ein Verstoß gegen das Abkommen somit wohl unvermeidbar. Dies zöge aber gravierende Konsequenzen nach sich: Selbst wenn die EU das Abkommen nicht (sofort) kündigen würde, wären Gegenmaßnahmen zu erwarten, die sich nicht auf den Bereich der Personenfreizügigkeit beschränken müssten, sondern zum Beispiel auch den freien Warenverkehr betreffen könnten – für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft keine erfreuliche Aussicht.
Initiative gegen Masseneinwanderung: . In: Legal Tribune Online, 17.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11027 (abgerufen am: 01.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag