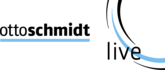Während die Geschichte der NS-Juristen nach und nach aufgearbeitet wird, findet die Fachliteratur kaum Beachtung. Dabei wurden viele Verlage nach 1933 zum Sprachrohr der Nazis. Wie konnte das geschehen und was haben sie daraus gelernt?
Das Unrecht des Nationalsozialismus hat Deutschland nie mehr losgelassen. Schuld, Sühne und Erinnerung sind eingemeißelt in das deutsche Staats- und Rechtsfundament. Auch die deutschen Juristen setzen sich, jedenfalls seit den späten 50-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und den Tagen Fritz Bauers, immer wieder mit der belasteten Vergangenheit ihrer Profession auseinander.
So gab Ex-Bundesjustizminister Heiko Maas jüngst ein Buch über "furchtlose Juristen" im Kampf gegen das NS-Unrecht heraus. 2016 stellte er zudem "Die Akte Rosenburg" vor, in der eine unabhängige wissenschaftliche Kommission den Verbleib von Nazi-Juristen im Bundesministerium der Justiz in der Nachkriegszeit aufarbeitete. Ähnliches unternimmt nun auch die Generalbundesanwaltschaft.
Die Geschichte derjenigen aber, die für die Literatur und damit die ideologische Unterfütterung für das Unrechtsregime sorgten, findet bis heute öffentlich kaum Beachtung. Das mag zum einen daran liegen, dass die wenigsten vom NS-Erbe der juristischen Fachverlage überhaupt wissen. Zum anderen dürften die Unternehmen selbst wenig Interesse daran haben, problematische Veröffentlichungen im eigenen Haus nach so langer Zeit noch einmal aufzurollen. Dabei musste erst jüngst der C.H. Beck Verlag bei der Posse um die Namensgebung des Palandt-Kommentars erfahren, welchen Gegenwind die NS-Vergangenheit erzeugen kann. Auch wenn die meisten Zeitschriften heute nicht mehr (oder nicht mehr unter ihrem damaligen Namen) erscheinen, existieren die herausgebenden Institutionen sehr wohl noch.
Sprachrohr für Rassenideologie: Die Deutsche Juristenzeitung
Während die Nazis z. T. eigene Publikationen gründeten (darunter die Zeitschrift Deutsches Recht), die ihre Ideologie in die Wissenschaft transportierten, machten sich auch die bereits etablierten Fachmedien nach der Machtergreifung mit ihnen gemein.
Eine der zu dieser Zeit einflussreichsten Fachzeitschriften war die Deutsche Juristenzeitung (DJZ), nicht zu verwechseln mit der heute im Verlag Mohr Siebeck erscheinenden Juristenzeitung (JZ). Die DJZ erschien von 1896 bis 1936, zunächst im Verlag Otto Liebmann, später im Beck-Verlag, ehe sie zum Organ der "Akademie für Deutsches Recht" wurde. Nachdem Namensgeber und Inhaber Otto Liebmann (1865-1942), selbst Jude, der NS-Führung in der Zeitung zu Beginn noch gehuldigt hatte ("Nach langer Wintersnacht darf Deutschland hoffen, einem Wiederaufbau entgegenzugehen"), sah er sich unter dem größer werdenden Druck Ende 1933 gezwungen, seinen Verlag an C. H. Beck zu verkaufen, der auch die DJZ zunächst weiterführte.
Nachdem schon unter Liebmann überschwängliche Grußworte u. a. des Deutschen Richterbundes (DRB) und des Deutschen Anwaltvereins (DAV) an die neue Nazi-Regierung in der DJZ erschienen waren, wurde dort später reinste Rassenideologie verbreitet. Gleich in der ersten Ausgabe der DJZ nach Inkrafttreten des Ermächtigungsgesetzes erschien ein Artikel mit dem Titel "Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich". Autor war Carl Schmitt (1888-1985), einer der bald führenden NS-Juristen.
Die Informationen stammen von Bernd Rüthers und Martin Schmitt. "Es war den Nationalsozialisten offenbar in besonderer Weise gelungen, die Autoren der Deutschen Juristenzeitung für ihr national-konservatives Regierungsbündnis zu faszinieren" schrieben sie 1988 in einem der wenigen wissenschaftlichen Aufsätze zum Thema (JZ 1988, S. 369-377).
Neben der DJZ gab der Beck-Verlag auch andere nationalsozialistisch beeinflusste Werke heraus, am prominentesten vielleicht die Kommentare zur deutschen Rassegesetzgebung der beiden Reichsinnenministeriumsfunktionäre Wilhelm Stuckart (1902-1953) und Hans Globke (1898-1973).
"Werkzeug nationalsozialistischer Rechtsideologie"
Auch die Neue Juristische Wochenschrift (NJW), eine der heute renommiertesten juristischen Fachzeitschriften, hat mittelbar eine Vorgeschichte im Nationalsozialismus. Zwar erscheint sie erst seit 1947 (seit 1949 bei C. H. Beck) und der Beck-Verlag betont, dass es sich um eine "eigenständige Neugründung" gehandelt habe. Doch ihre Begründer verheimlichten nicht, mit ihr die Tradition der Juristischen Wochenschrift (JW) fortsetzen zu wollen: "Wir wollen anknüpfen an die Tradition der alten 'Juristischen Wochenschrift', die Jahrzehnte hindurch, geprägt von Persönlichkeiten wie Hachenburg und Magnus, das repräsentative Organ der deutschen Rechtsanwaltschaft gewesen ist" heißt es im Geleitwort von Herausgeber und Verlag in der ersten Ausgabe 1948. Die JW war bis 1939 – zunächst im Berliner Verlag Weidmann, später beim Leipziger Verlag Moeser – erschienen und wurde nach der Machtübernahme ebenfalls stark von nationalsozialistischem Rechtsverständnis beeinflusst. "Die Juristische Wochenschrift war innerhalb weniger Wochen zu einem Werkzeug nationalsozialistischer Rechtsideologie und Justizpraxis geworden" schreiben Rüthers und Schmitt dazu.
Ebenso machte sich die Deutsche Richterzeitung (DRiZ), die bis heute unter diesem Namen erscheint und vom Deutschen Richterbund (DRB) zunächst mit dem Carl Heymanns Verlag, seitdem mit dem Beck Verlag herausgegeben wird, mit den Nationalsozialisten gemein. So erschienen dort laut Rüthers/Schmitt ab 1933 Artikel, in denen gefordert wurde, das Richteramt an ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus zu knüpfen und die Auffassungen "nicht arischer Schriftsteller" zu ignorieren.
Im Carl Heymanns Verlag wurden zudem Werke verlegt wie die Erläuterung zur Gesetzgebung des Dritten Reiches von Erwin Noack (1899-1967), in dem sich Kapitel fanden wie "Maßnahmen zur Zurückdrängung des völkisch Unerwünschten" oder "Läuterung des Volkskörpers".
Der Verlag Mohr Siebeck – damals noch J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) – versprach damals öffentlich, seine Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (ZgS) "im Geiste unserer Zeit neu zu beleben". Oskar Siebeck (1880–1936), der gute Kontakte zu Carl Schmitt unterhielt, verbannte viele Autoren und Herausgeber aus seinem Verlag und wollte ihn Stück für Stück den neuen Gegebenheiten gemäß umbauen. Zudem gab es auch Beispiele wie den J.F. Lehmanns Verlag, der schon vor 1933 die Zeitschrift Volk und Rasse verlegte.
"Alle haben mitgemacht"
Wie aber konnte es dazu kommen, dass Verleger, von denen viele zuvor als liberal gegolten und für Meinungspluralismus gestanden hatten, binnen kürzester Zeit der Nazi-Ideologie erlagen? Ulrike Henschel, Rechtsanwältin und heute Geschäftsführerin und Verlagsleiterin in der Verlagsgruppe C.H. Beck, fragte in ihrer Dissertation "Vermittler des Rechts – Juristische Verlage von der Spätaufklärung bis in die frühe Nachkriegszeit" (2015, De Gruyter): "Wie konnten ihre Autoren – akademisch bestens ausgebildet und von Berufs wegen mit Menschenwürde und Gerechtigkeitsgedanken befasst – solche Rechtsmeinungen äußern und das offensichtliche Unrecht durchsetzen?"
Bernd Rüthers hat sich bei seinen Nachforschungen dieselbe Frage gestellt: "Der Geist in den meisten Redaktionen änderte sich damals schlagartig" beschreibt er im Gespräch mit LTO die Entwicklung nach der Machtübernahme. Man habe sich "mit fliegenden Fahnen" der völkischen Rechtserneuerung hingegeben: "Die Verlage haben alle mitgemacht."
Rüthers, 1930 geboren, war bis zu seiner Emeritierung Professor sowie zwischenzeitlich auch Rektor der Universität Konstanz und wurde mit dem Thema "Die unbegrenzte Auslegung - Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus" (Tübingen 1968, 8. Aufl. 2017) habilitiert. Die Fähigkeit von Juristen, das Recht wechselnden Ideologien zu unterwerfen, hat ihn seitdem nie losgelassen. "Jede Diktatur neigt dazu, die Redaktionen der staatsnahen Zeitschriften auszuwechseln" erklärt Rüthers. "Entweder sie passten sich an oder sie wurden eliminiert. Das galt für alle jüdischen Redaktionsmitglieder wie auch für die meisten sozialdemokratischen."
Der Druck nach der Machtübernahme 1933 wuchs, nicht nur auf jüdische Verleger wie Liebmann. Henschel schildert in ihrer rechtshistorischen Abhandlung, wie die Verlage zunehmend Repressalien ausgesetzt waren. Das waren nicht nur die "harten" Lösungen wie die Schließung, sondern auch subtilere Maßnahmen. So erhielt bspw. der De Gruyter Verlag im November 1939 ein Schreiben des "Werbe- und Beratungsamts für das deutsche Schrifttum beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda". Darin wurde verlangt, künftig alle Veröffentlichungen vor Drucklegung an die Behörde zu senden, "damit rechtzeitig über die für die einzelnen Werke notwendigen Förderungsmassnahmen entschieden werden kann".
Für die Karriere
Die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitschriften ging mit der Nazi-Herrschaft nach und nach verloren, schon bald durften per Gesetz nur noch Arier die Schriftleitung übernehmen. So liegt die Vermutung nahe, dass den Redaktionen tatsächlich wenig Spielraum blieb, um kritische Stücke zu publizieren. Und doch drängt sich der Eindruck auf, dass sich Deutschlands Juristen auch dort beinahe übereifrig der neuen Macht anzubiedern versuchten. War das nur die Angst vor Repression? Und kann man Autoren überhaupt zwingen, von "Entjudung" zu schreiben oder das Ermächtigungsgesetz zu bejubeln?
Der Grund für die große Zahl an Nazi-Konvertiten war wohl eher recht pragmatisch: Man wollte Karriere machen. "Recht ist der Spiegel des gesellschaftlichen Wohlbefindens und dieses richtet sich nach Karrieremöglichkeiten", sagt Rüthers. Niemand habe das Karrierewettrennen unter dem neuen Regime gleich verloren geben wollen. Als Vorwurf menschlicher Unzulänglichkeit will er das aber nicht verstanden wissen: "Ich finde, es steht uns nicht zu, uns Pauschalurteile über eine ganze Epoche zu bilden. Dahinter stehen immer Einzelschicksale. Viele waren verheiratet, hatten Kinder, Verantwortung für ihre Familien."
Auch die Verlage hätten vor allem ihre Marktposition im Sinn gehabt, schreibt Henschel: Man habe versucht, "sich in der Nähe der Regierungskreise zu positionieren und dadurch die frühere Marktstellung zu bewahren", auch wenn dies "mit weitestgehenden Zugeständnissen an die neuen Machthaber" verknüpft gewesen sei.
Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft ging es dann um die Rückkehr ins Geschäft. Zerbombte Verlagsgebäude und Lizenzprobleme aufgrund der belasteten Vergangenheit wie bei Beck erschwerten dieses Unterfangen. Die Aufklärung der eigenen Geschichte musste da hintanstehen. So wurde der Zeitraum zwischen 1933 und 45 in den Verlagsgeschichten lange ausgespart, so Henschel. "Was im Systembruch 1933 funktionierte, war für die juristischen Verlage auch 1945 in der Bundesrepublik eine Strategie“ schreibt sie und meint: schnellstmögliche Anpassung. Diese gelang, wie in anderen Teilen der Gesellschaft auch, nicht ohne Personal mit Nazi-Vergangenheit. So schrieb zum Beispiel der prominente NS-Jurist und Carl Schmitt-Schüler Ernst Forsthoff auch nach 1945 weiter sowohl für C. H. Beck als auch für den Verlag W. Kohlhammer.
Späte Aufarbeitung
Wie aber gehen die Verlage heute mit ihrer Vergangenheit um? Haben sie Konsequenzen gezogen? "Erst in den letzten Jahren", so schreibt Henschel 2015, hätten sich einige Verlage der eigenen dunklen Historie gewidmet. Ein Interesse, das sicherlich auch mit gesellschaftlichem Druck zu tun habe.
Der C. H. Beck Verlag weist auf Anfrage von LTO auf die "zahlreiche(n) Bücher zur Geschichte des Nationalsozialismus" hin, die im Verlag seither erschienen seien und "volumenmäßig vermutlich von keinem anderen deutschen Verlag übertroffen werden". Zudem hat man 2013 anlässlich des 250-jährigen Verlagsjubiläums zwei Verlagsgeschichten publiziert: "250 Jahre rechtswissenschaftlicher Verlag C.H.Beck 1763 – 2013“ von Uwe Wesel und "C.H.Beck 1763 - 2013. Der kulturwissenschaftliche Verlag und seine Geschichte" von Stefan Rebenich.
Den Streit innerhalb der Verlegerfamilie über die historische Rolle des Vaters Heinrich Beck haben die Untersuchungen nicht befriedet. Der Auftrag dazu kam jeweils vom Leiter der Sparte, Dr. Hans-Dieter Beck für die juristische, Wolfgang für die kulturwissenschaftliche. Die beiden Werke wurden im Rahmen der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Dort kam es bei der Jubiläumsfeier zu einem – so formuliert es der Verlag – "kontroversen Austausch" zwischen den beiden Autoren. Zeitungen nannten es damals Eklat. Bernd Rüthers war dabei. Er erinnert sich, dass die beiden Männer mitunter ausfallend geworden seien. Wie auch ihre Auftraggeber, die zerstrittenen Beck-Brüder, zeigten sie deutliche Differenzen beim Verständnis der Verlagsgeschichte im Dritten Reich. U.a. sah der 1961 geborene Rebenich im Kauf des Otto Liebmann Verlags ein deutliches Beispiel für die Arisierung der Verlage, da Liebmann nicht aus freien Stücken verkauft habe. Der damals 81-jährige Wesel, vom älteren Bruder Hans Dieter beauftragt, widersprach energisch. Heinrich Beck habe einen angemessenen Preis bezahlt - und Rebenich als zu spät Geborener ohnehin keine Ahnung von dieser Zeit.
Mohr Siebeck räumt auf LTO-Anfrage ein, dieses Thema sei im Haus "noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet". Obwohl man sich darum bemüht habe, schreibt Geschäftsführer Dr. Henning Ziebritzki in seiner Antwort: "Wir haben mehrfach versucht, Dissertationen oder andere wissenschaftliche Studien zu dem Thema anzuregen, ohne dass wir damit erfolgreich gewesen wären."
Der Carl Heymanns Verlag, heute vollständig in den Informationsdienstleister Wolters Kluwer Deutschland integriert, zu dem auch LTO gehört, habe seine Geschichte mehrfach aufgearbeitet, erklärt Stephanie Walter, Geschäftsführerin und Leiterin des Geschäftsbereichs Legal gegenüber LTO; zuletzt in einer 2015 erschienenen Festschrift zum 200-jährigen Jubiläum "durch den unabhängigen Berliner Autor und Historiker Dr. Erik Lindner". Nach dessen Erkenntnissen habe der Verlag lange in die Kategorie der "unsicheren Kantonisten" gehört und während der NS-Zeit mehrfach vor der Schließung gestanden, was, so Walter, "sicher nur bedingt entlasten" könne. Der Historiker Lindner habe in seinen Recherchen gleichwohl nicht mehr nachvollziehen können, "wie und von wem NS-Publikationen bei Carl Heymanns angebahnt und durchgeführt wurden".
"Aus einer Geschichte, die man nicht kennt, kann man nichts lernen"
Welche Lehren aber kann man aus einer Geschichte ziehen, die man selbst nicht wirklich kennt?
Der Beck-Verlag teilt lediglich mit, heute gelte, dass „unsere Autoren auch mit widerstreitenden Meinungen zu Wort kommen können und sollen, solange sich diese im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewegen." Stephanie Walter von Wolters Kluwer versichert, alle eingereichten Werke würden "intensiv geprüft" und neue Publikationen "insbesondere auch auf Konsistenz mit den Werten geprüft, für die Wolters Kluwer weltweit steht".
Bernd Rüthers‘ Meinung zur Rolle der Verlage ist klar: "Wer Bücher verlegt, übernimmt Verantwortung für die Wirkung dieser Bücher", betont er im LTO-Gespräch. Und die Verantwortung, die Geschichte des Nationalsozialismus nicht zu tabuisieren, bleibe auch heute bestehen: "Wenn dieselbe Situation heute eintreten würde, würden sich die Juristen und anderen staatsnahen Disziplinen wohl nicht viel anders verhalten als die Generation nach 1933 und nach 1945 und 1949."
Insofern wiegt für ihn, der sich ein Leben lang mit der juristischen Auslegungsmethodik und ihrem Missbrauch auseinandergesetzt hat, die Pflicht zur Aufarbeitung umso schwerer: „Die Rechts- und die juristische Methodengeschichte ist auf den Universitäten Jahrzehnte lang gezielt beschwiegen worden. Ganze Generationen sind so mit falschen Geschichtsbildern in den Juristenberuf gelangt" kritisiert Rüthers. "Aus einer Geschichte, die man nicht kennt, kann man nichts lernen."
Juristische Fachverlage im 3. Reich: . In: Legal Tribune Online, 07.08.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/36923 (abgerufen am: 05.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag