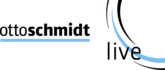Ein populäres Kinderlied behauptet: "Die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, festgestellt, dass Marmelade Fett enthält". Dank boulevardjournalistischer Aufbereitung werden vor allem die Ergebnisse US-amerikanischer Wissenschaft oft als besserer Witz dieser Art wahrgenommen. Die US-Forschung zur Angst unter Juristen hat dies vielleicht nicht verdient.
Menschliche Angst ins Zentrum rechtswissenschaftlicher Forschung zu stellen, dürfte im deutschen Schrifttum dieser akademischen Zunft eher selten zu finden sein. Bei allen Vorbehalten, die man angesichts der oft Public-Relations-optimierten Wissenschaftsberichterstattung US-amerikanischer Provenienz haben mag – in diesem Forschungsfeld finden sich Darstellungen, die uns die Angst auf interessante Weise näherbringen.
Beispielsweise informiert Debra S. Austin, Professorin für juristische Grundlagenkenntnisse am Denver Sturm College of Law, darüber, dass das Gehirn eines Jura-Studenten drei Pfund (1,36 kg) wiege, den Umfang einer Kokos- und die Gestalt einer Walnuss habe und der Substanz gefrorener Butter gleiche. Einen kleinen Schreck unter Professorenkollegen könnte es auslösen, dass Austin behauptet, die Gehirne von Juraprofessoren seien von gleicher Größe.
Intellektuelle Fitness ist standesrechtlich geboten
Die grundsätzliche Beschäftigung mit dem Juristenhirn (und einigen anderen grauen Zellen) folgt indes keinem rein launigen Zweck. Programmatisch behauptet die US-Juristin, dass die moderne Neurowissenschaft Aufschluss darüber gebe, wie ein "neuronal self-hacking" die kognitive Leistungsfähigkeit steigern könne.
Training in neuronaler Selbstoptimierung, das wirkt aus alteuropäischer Juristenperspektive sicher ein wenig amerikanisch-verdreht. Vielleicht ist man noch daran gewöhnt, von Rechts wegen nur forensisch mit dem menschlichen Gehirn befasst zu werden: dargeboten als psychiatrisches Gutachten im Strafprozess oder – im Fall obskurer rechtshistorischer Interessen – in Gestalt des Verbrecherhirns, das in Formaldehytlösung im Einmachglas schwimmt.
Sich des eigenen Juristenhirns anzunehmen, hat neben humanistisch-pädagogischen Erwägungen für die US-Professorin eine positivrechtliche Komponente. So deduziert sie aus einer standesrechtlichen Vorschrift der amerikanischen Rechtsanwaltsvereinigung, die eine allgemeine Fortbildungspflicht formuliert, dass sich Anwälte im Interesse ihrer Klienten um neurowissenschaftliche Optimierung ihrer kognitiven Fähigkeiten bemühen müssten.
Ihr humanistisch-pädagogisches Interesse am Stress begründet Austin damit, dass der Stress, dem Jurastudenten und Rechtsanwälte begegneten, Gehirnzellen sterben lasse und "in einem signifikanten Rückgang des Wohlbefindens [mündet], einschließlich Ängsten, Panikattacken, Depressionen, Drogenmissbrauch und Suizidneigung".
Jura verstärkt "psychopathological symptom responses"
Manche Empfehlung, die Professor Austin in ihrem 70-seitigen Aufsatz formuliert – einer Darstellung in der sie fleißig vom Gehirn der gemeinen Laborratte zum Juristengehirn und wieder zurück wechselt – gehört in die Abteilung Psychologie nach Hausmacherart: Dass das Gedächtnis wenig aufnahmefähig sei, wenn es unaufhörlich mit Buchwissen konfrontiert werde und körperliche Entspannung her müsse, zählt beispielsweise dazu.
Ein wenig profan, aber doch bemerkenswert, ist ihr Hinweis auf verbesserte kognitive Lernleistungen an US-amerikanischen Schulen, die ihre Eleven in den 1990er-Jahren mit systematischen Aerobic-Übungen traktierten. Dieser Zusammenhang von geistiger und körperlicher Bewegung ist immerhin so evident, dass man sich eigentlich wundern muss, dass nach hiesiger Kenntnis noch kein privatwirtschaftliches Repetitorium seine Kundschaft neben Skripten und Kommentaren auch Hanteln stemmen lässt, um damit die Befähigung zum Richteramt zu befördern.
Das US-amerikanische Interesse an den Auswirkungen des Jurastudiums auf das menschliche Gehirn ist notorisch. Bereits 1986 präsentierten drei Psychiater im Forschungsjournal der American Bar Associaton die Erkenntnis, dass durch das Studium der Jurisprudenz ein zuvor normaler Grad an "psychopathological symptom responses" signifikant erhöht werde.
Martin Rath, Juristenpsychologie: . In: Legal Tribune Online, 05.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13391 (abgerufen am: 03.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag