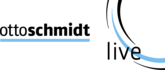Die EU plant die Einführung eines neuen Systems zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten und Investoren. Gegenüber Vietnam kommt es schon zum Einsatz, auch für TTIP könnte es genutzt werden. Von Alexandra Diehl und Heiko Heppner.
Viele Jahre lang beschäftigten sich nur Spezialisten mit Investitionsschiedsverfahren. Seit Aufnahme der Verhandlungen über das Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) ist dies anders: Die breite Öffentlichkeit diskutiert über die dort geplante Form der Streitbeilegung zwischen Staaten und Investoren, es herrscht Furcht vor einer Aushöhlung der Demokratie durch geheime Schattengerichte. Die EU reagiert ihrerseits mit dem Vorschlag eines stärker verstaatlichten Gerichtssystems, und setzt dieses Modell in einem Freihandelsabkommen mit Vietnam bereits um.
Ihr Vorstoß wird von Experten vielfach kritisiert, da er das bestehende, funktionierende Modell der Streitbeilegung im Investitionsschutzrecht ohne Not gefährde. Dies tut dem couragierten EU-Projekt allerdings Unrecht: Es könnte der Geburtshelfer einer nützlichen Reform des Investitionsschutzrechts werden.
Vor Erfindung der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit waren deutsche Investoren in vielen Ländern der Welt schutzlos staatlicher Willkür ausgeliefert. Wurde ihnen ihr Eigentum durch staatliche Maßnahmen entzogen oder entwertet, gab es zwei Möglichkeiten: Der Investor konnte die Gerichte des Gaststaates anrufen oder die Bundesrepublik um diplomatischen Beistand bitten. Ersteres scheiterte häufig an fehlendem Grundrechtsschutz im Gastland oder der Parteilichkeit seiner Gerichte. Letzteres machte die berechtigten Interessen des Einzelnen zum Spielball politischer Opportunität.
Investitionsschutz dient auch staatlichen Interessen
Hier schloss die Schiedsgerichtsbarkeit eine wichtige Rechtsschutzlücke. Dies gelang – anders, als häufig behauptet – nicht durch einseitig von Konzernlobbyisten ausgeübten Druck, sondern weil ein Großteil aller Staaten untereinander Vereinbarungen traf, um die Position der inländischen Industrie im Ausland wechselseitig zu stärken. "Exportweltmeister" ist Deutschland übrigens auch in dieser Hinsicht: Kein anderes Land trieb den Abschluss solcher Verträge mit gleichem Nachdruck voran.
Solange sich Investorenklagen vor allem gegen nicht immer rechtsstaatlich orientierte Drittländer richteten, erregten diese Verfahren hierzulande kaum Aufmerksamkeit. Dies änderte sich jedoch mit der Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall gegen Deutschland infolge des 2011 beschlossenen Atomausstiegs. Das Verfahren brachte die Frage von Sinn und Unsinn des Investitionsschutzes in die Öffentlichkeit: Wie nötig und berechtigt ist ein direkter Klageweg von Unternehmen gegen fremde Staaten, die demokratisch legitimierte Entscheidungen treffen? Brauchen wir ihn im Verhältnis EU-USA?
Demokratie ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Die Gerichte manches osteuropäischen EU-Staates liegen im Transparency International-Korruptionsindex hinter Saudi-Arabien – und auch amerikanische Gerichte genießen außerhalb der USA kein uneingeschränktes Vertrauen. Auch TTIP braucht daher ein Streitbeilegungssystem für investitionsrechtliche Streitigkeiten. Die Frage ist nur welches.
Gut zwei Drittel bisheriger Verfahren gegen Investoren entschieden
Die EU-Kommissarin Cecilia Malmström hat mit ihrem Vorschlag eines zwischenstaatlichen Gerichtssystems eine Antwort gegeben. Auch diese stößt aber auf Widerspruch. Angeheizt durch Fernsehbeiträge wie "Konzerne klagen, wir zahlen" (ARD, 19. Oktober 2015) befürchten viele Bürger, dass die Kosten der Verfahren letztlich auf dem Steuerweg bei ihnen hängen bleiben.
Diese Befürchtung ist allerdings mit Blick auf das bisherige System überwiegend unbegründet: Gemäß der Datenbank der United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) wurden von den bis 2014 abgeschlossenen, bekannten 274 Investitionsschiedsverfahren nur 31% zugunsten der klagenden Investoren entschieden.
Auch besonders beachtete Investitionsschiedsverfahren zu wichtigen politischen Fragen wie dasjenige von Philip Morris gegen Australien deuten nicht auf eine übermäßige Investorenfreundlichkeit hin. Die Schadensersatzklage richtete sich gegen den australischen "Tobacco Plain Packaging Act 2011", der neutrale Zigarettenschachteln ohne Markenlogo vorschreibt. Der Fall wurde als Beispiel dafür angeführt, wie Unternehmen Staaten durch Investitionsschiedsverfahren am Schutz ihrer Bürger und der Umwelt hindern. Das Philip Morris-Schiedsgericht mit dem deutschen Vorsitzenden Karl-Heinz Böckstiegel wies die heiß diskutierte Klage aber im Dezember 2015 ab.
Der Beweis, dass Staaten regelmäßig aus Furcht vor (Schieds)Klagen Gesetze nicht erlassen, steht also aus. Gleiches gilt für den Beweis, dass ein Staat in einem Schiedsverfahren zu Unrecht zu Schadensersatz verurteilt worden wäre. Dass eine Entscheidung demokratisch legitimiert ist und sinnvollen Zielen dient, gleichzeitig aber Eigentumsrechte fremder Unternehmen verletzt und diesen gegenüber zum Ersatz verpflichtet, schließt sich gedanklich und rechtlich keineswegs aus. Hieran anknüpfende Klagen sind auch im Inland denkbar, wie die Millionenklage von RWE gegen das Land Hessen und die Bundesrepublik wegen der Schließung von Biblis vor dem Landgericht Frankfurt zeigt.
TTIP und mehr - EU plant neues Gerichtssystem: . In: Legal Tribune Online, 12.01.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/18106 (abgerufen am: 05.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag