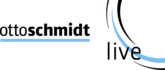Schutzpflichten, Gleichbehandlung, Teilhabe – Anna Katharina Mangold erklärt im Interview, was die Verfassungsdogmatik angesichts der drohenden zweiten Corona-Welle beitragen kann und wo sie an ihre Grenzen kommt.
LTO: Frau Professorin Mangold, alle reden über die "zweite Welle", und so langsam gewöhnt man sich daran, dass es keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2-Virus gibt. Wieviel "Restrisiko" müssen wir aushalten? Und inwiefern ist der Staat verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu ergreifen?
Anna Katharina Mangold: Das Bundesverfassungsgericht kennt zwar ein Untermaßverbot bei grundrechtlichen Schutzpflichten, wonach die staatlichen Stellen tätig werden müssen, etwa um Leben und Gesundheit der Bürger zu schützen. Aber Karlsruhe überlässt dem Gesetzgeber und den Behörden einen sehr weiten Einschätzungsspielraum. Insgesamt lassen sich aus dem Grundgesetz (GG) kaum konkrete Pflichten ableiten. Ich kenne nur ein Beispiel, in dem das Verfassungsgericht ganz detaillierte Vorgaben gemacht hat: Bei den Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch.
In vielen Bundesländern geht der Schulunterricht wieder los – mit Präsenzunterricht und unterschiedlich strengen Regeln. So gibt es etwa nur vereinzelt eine Pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Was bedeutet das für Kinder oder Lehrer, die zur Risikogruppe gehören?
Wenn nicht einmal solche Schutzmaßnahmen getroffen werden, die nach dem aktuellen Wissenstand effektiv und gut umsetzbar wären – dann muss man sich schon fragen, ob die Behörden hier das Untermaßverbot verletzen. Es gibt ja eigentlich sehr innovative Ideen und Konzepte, den Unterricht zu ermöglichen. Die Schutzpflichten gelten dabei natürlich auch für die Eltern bzw. nahestehende Personen, die mit dem Kind zusammenleben. Auch ihre Belange müssen berücksichtigt werden.
Kinder, die ein besonderes Risiko haben, schwer zu erkranken, können sich durch ärztliches Attest von der Schule befreien lassen. Bleibt ihnen dann nur die Möglichkeit, allein zu Hause zu lernen? Oder haben sei einen Anspruch auf besondere Angebote – etwa digitalen Unterricht?
 Hier geht es um Teilhabe an der Gesellschaft, indem man ein Recht auf Bildung aus dem Grundgesetz ableitet. Teilhaberechte sind aber grundrechtlich noch weniger ausdifferenziert als Schutzpflichten. Wir kennen zwar das sozialrechtliche Existenzminimum, das aus der Wahrung der Menschenwürde gemäß Art. 1 GG hergeleitet wird. Aber darüber hinaus wird das GG selten so interpretiert, dass es soziale Ansprüche liefern würde. Es wäre schon sehr innovativ, etwa eine Verfassungsbeschwerde darauf zu stützen, dass diese Kinder einen Anspruch auf Bildung geltend machen können und so ganz konkrete Maßnahmen, etwa gesonderte digitale Lernangebote, einzufordern. Allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass das Bundesverfassungsgericht sich damit sogar auseinandersetzen würde.
Hier geht es um Teilhabe an der Gesellschaft, indem man ein Recht auf Bildung aus dem Grundgesetz ableitet. Teilhaberechte sind aber grundrechtlich noch weniger ausdifferenziert als Schutzpflichten. Wir kennen zwar das sozialrechtliche Existenzminimum, das aus der Wahrung der Menschenwürde gemäß Art. 1 GG hergeleitet wird. Aber darüber hinaus wird das GG selten so interpretiert, dass es soziale Ansprüche liefern würde. Es wäre schon sehr innovativ, etwa eine Verfassungsbeschwerde darauf zu stützen, dass diese Kinder einen Anspruch auf Bildung geltend machen können und so ganz konkrete Maßnahmen, etwa gesonderte digitale Lernangebote, einzufordern. Allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass das Bundesverfassungsgericht sich damit sogar auseinandersetzen würde.
"Für wen wirken sich Coronamaßnahmen besonders nachteilig aus?"
Führt die Corona-Pandemie dazu, dass man im Verfassungsrecht mehr über soziale Fragen diskutieren muss?
Ja, die Coronakrise hat die sozialen Schieflagen ganz deutlich gemacht: Für wen wirkt es sich denn besonders nachteilig aus, wenn die Schulen geschlossen werden? Etwa auf sozioökonomisch benachteiligte Kinder und deren Eltern. Diese Kinder haben zu Hause viel schlechtere Bedingungen weiter zu lernen, oft fehlen schon Computer oder Tablets, um an digitalen Unterrichtsangeboten teilnehmen zu können. Oder Mütter: Sie müssen viel öfter beruflich zurückstecken, womöglich sogar ihren Job kündigen, um Kinder zu betreuen.
Diese sozialen Fragen kommen bisher in der Grundrechtsdogmatik zu wenig vor. Wir müssen viel mehr über die soziale Dimension der Grundrechte diskutieren. Es geht darum, wie wir Menschen überhaupt in die Situation versetzen können, in der sie ihre Grundrechte tatsächlich wahrnehmen können. Allerdings ist das auch etwas, was die Gerichte nicht allein lösen können. Wir brauchen auch politische Entscheidungen.
In den vergangenen Wochen wurden viele Einschränkungen gelockert, aber längst nicht alle. Es gibt etwa in vielen Alten- und Pflegeheimen oder in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen immer noch strenge Hygienekonzepte, die teilweise Besuche und Ausgänge einschränken. Ist das noch verhältnismäßig?
Je nachdem wie die Regelungen ausgestaltet sind, kann das eine sehr dramatische Situation für die Bewohner und auch die Angehörigen sein. Wenn etwa Menschen daran gehindert werden, rauszugehen –wobei sie womöglich auf Begleitung von Angehörigen angewiesen sind –, dann ist das schon an der Grenze zur Freiheitsentziehung. Aber das Kernproblem ist hier auch ein soziales: Schon vor der Coronakrise gab es viel zu wenig Pflegepersonal, die Jobs sind schlecht bezahlt, die Arbeitszeiten teilweise unmenschlich. Daran hat sich nichts geändert. Und jetzt, in der Krise, fällt es eben ganz besonders auf, dass man viel mehr Pflegekräfte braucht, um wirklich eine menschenwürdige Pflege zu ermöglichen.
"Das Grundgesetz kennt kein Verbot der Altersdiskriminierung"
Darf man älteren Menschen besonders strikte Einschränkungen auferlegen – um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern und so das Gesundheitswesen zu entlasten? Ist das eine Diskriminierung?
Das Problem: Das GG kennt schlicht kein Verbot der Altersdiskriminierung – zwar gibt es eines im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das aber nur im beruflichen Kontext gilt und hier keine Rolle spielt. Der Europäische Gerichtshof hat zwar 2005 in der sogenannten Mangold-Entscheidung – keine Verwandtschaft übrigens – aus dem blauen Himmel heraus ein allgemeines Verbot der Altersdiskriminierung erfunden, diese Rechtsprechung ist hier jedoch auch nicht anwendbar, weil es nicht um Unionsrecht geht.
Bei alten oder kranken Menschen handelt es sich nicht um die Diskriminierung einer kategorial bestimmten Personengruppe wie bei rassistischer oder sexistischer Diskriminierung. Stattdessen geht es um ein übliches Typisierungskriterium, das auch bei Regelungen zum Wahlalter, zur Geschäftsfähigkeit oder zum Führerschein angewendet wird. Denkbar ist also eigentlich nur eine Prüfung am allgemeinen Gleichheitssatz, die möglicherweise wegen der Unverfügbarkeit des Alters einer Person ähnlich streng zu behandeln wäre, wie die verbotenen Ungleichbehandlungen des Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG – es muss also einen gewichtigen sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung geben und sie muss verhältnismäßig sein. Meines Wissens hat das Bundesverfassungsgericht das bislang aber noch nicht so gehandhabt.
Grundsätzlich darf der Staat also von einzelnen Gruppen Sonderopfer verlangen, um die Bevölkerung insgesamt zu schützen?
Das kann in bestimmten Fällen zulässig sein, es gilt aber eine sehr strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dabei sollte man übrigens bedenken, dass so etwas auch in weniger direkter, mittelbarer Form geschieht. Wenn etwa Kitas und Schulen geschlossen werden, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, dann trifft das überproportional Eltern und noch stärker Alleinerziehende, unter denen wiederum sehr viele Frauen sind. Dann handelt es sich um eine rechtfertigungsbedürftige faktische Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts, die am Maßstab von Art. 3 Abs. 2 und 3 GG zu prüfen ist. Wie gesagt: Bestimmte Beschränkungen können zulässig sein, es muss aber stets genau geprüft werden, ob einer Personengruppe in der Bevölkerung ein Sonderopfer auferlegt wird und werden darf.
"Aus verfassungsrechtlicher Perspektive bisher glimpflich durchgekommen"
Am Anfang der ersten Welle sagte der Berliner Rechtsprofessor Christoph Möllers im Interview mit LTO, die Bundesregierung gehe mit den Corona-Maßnahmen "im Moment bis an rechtsstaatliche Grenzen, aber nicht klar darüber hinaus". Vom jetzigen Standpunkt aus gesehen: Wie rechtsstaatlich verläuft die Bewältigung der Coronakrise?
Erstmal gab es eine starke exekutive Reaktion mit weitgehenden Eingriffen – aber das war eben auch eine Ausnahmesituation. Mit zunehmendem Wissen über das Virus haben sich die Reaktionen darauf verändert. Und es zeigt sich, dass die Gerichte nun den Grundrechtsschutz hochhalten. Am Anfang waren sie relativ großzügig, aber nach und nach wurde klar, dass Einschränkungen zurückgenommen werden müssen – etwa bei der Versammlungsfreiheit oder bei der Religionsfreiheit. Ich denke, aus verfassungsrechtlicher Perspektive sind wir bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen.
Zunächst hatte die Bundesregierung auf möglichst einheitliche Maßnahmen gedrängt – nach und nach zeigen sich aber große Unterschiede zwischen den Ländern. Ist das sinnvoll?
Es ist durchaus sinnvoll, mit verschiedenen Maßnahmen auf ein unterschiedliches Infektionsgeschehen zu reagieren. Aber momentan habe ich den Eindruck, wir landen in manchen Bereichen zu sehr in der Kleinstaaterei: Man muss jetzt Vorkehrungen treffen, um die zweite Welle zu vermeiden oder jedenfalls möglichst gut zu bewältigen. Und ich sehe teilweise keine Gründe dafür, dass solche Vorkehrungen in Bayern ganz anders ausfallen sollten als in Mecklenburg-Vorpommern. Das wir etwa für den Schulbeginn so unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern haben, das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil die Gefahrenlage ja überall gleich ist. Das müssten die Länder besser untereinander koordinieren, um kein unterschiedliches Schutzniveau zu generieren.
Prof. Dr. Anna Katharina Mangold, LL.M. (Cambridge), lehrt Öffentliches und Europäisches Recht an der Europa-Universität Flensburg und forscht insbesondere im Bereich Antidiskriminierung. Sie ist Mitherausgeberin des Verfassungsblogs.
Verfassungsrecht und die zweite Corona-Welle: . In: Legal Tribune Online, 14.08.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42490 (abgerufen am: 02.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag